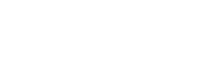Was uns die Berge erzählen
Die Alpen sind einzigartig. Egal aus welcher Perspektive ich meinen Blick auf diese Berge richte, sie bleiben für mich das schönste, spannendste und interessanteste Gebirge der Welt. Eine mit Sicherheit gewagte Aussage, denkt man an die Riesen des Himalayas, die Einsamkeit der Alaska Range, die Ausdehnung der Anden. Die Gebirge unserer Erde sind von Superlativen durchzogen, während die bescheidenen Alpen in diesen Ranglisten meist nicht zu finden sind. Ich gebe zu, vielleicht spielen bei meiner Bewertung auch eine ordentliche Portion subjektiven Heimatgefühls und Vertrautheit eine tragende Rolle.
Warum kann ich mir dieses Urteil überhaupt erlauben? Ich bin kein großer Bergsteiger, kein besonders herausragender Snowboarder und auch kein führender Wissenschaftler des Alpenraums. Ich bin vielleicht von allem ein wenig… Primär bin ich jedoch Kind. Jedes Mal, wenn ich mich den Alpen nähere, egal ob in alpinistischer oder wissenschaftlicher Mission, werde ich wieder zum Kind. Voller Neugier studiere ich die Schneelage, suche nach Anzeichen für Felsstürze oder Lawinen, halte Ausschau nach Gämsen oder mache mir Gedanken über die geologischen Prozesse, welche die Baumeister dieser einmaligen Landschaft sind. Kurz: Tausende von Gipfeln, verwinkelte Täler, versteckte Almen und letztlich das sagenhafte Licht, welches immer unterschiedliche Aspekte dieser Landschaft betont, erfüllen mich mit einer Neugier die ich nur noch aus Kindertagen kenne.

Meine persönliche Geschichte in den Alpen begann auf der Gamsjagd mit meinem Vater in Kärnten. Auch wenn es immer wieder nach erfundener Prosa klingt, es war tatsächlich so, und ich bin dankbar für diesen einzigartigen Zugang zur Natur, der mir in meiner Kindheit ermöglicht wurde und mich bis heute begleitet. Ich habe zwar (außer auf Spitzbergen vielleicht) mit Waffen nichts mehr am Hut und schieße lediglich mit meiner Kamera auf Steinböcke. Aber es ist nicht übertrieben, wenn ich behaupte, dass mir der Naturwissenschaftler auf diesen Vater-Sohn Expeditionen in die Wiege gelegt wurde. Ein Wandel kam natürlich mit der Pubertät. Das Fernglas und die Ski wurden gegen ein Snowboard und später gegen ein Splitboard eingetauscht. Die erste Alpenüberquerung kam dann im Studium. Es folgten weitere Exkursionen als Student und später als Leiter und Dozent an der Uni. Die Alpen wurden der Ausgleich zu meiner Arbeit am Schreibtisch. Durch sie verzögerte sich meine Doktorarbeit und inspiriert durch die Exkursionen gründete ich FRAM. Ich habe mich viel mit Gletscherrekonstruktion beschäftigt und diverse Wälzer über den Naturraum der Alpen gelesen. Die Rolle des Menschen in diesen Bergen interessierte mich dabei zunächst herzlich wenig. Dies änderte sich erst durch meine Aufenthalte auf der Mitterkaseralm im Pfossental.

Die Alpen als Kulturlandschaft
Die Alm liegt mitten im südtiroler Pfossental, einem Seitental des Schnalstales, welches direkt ins Vinschgau mündet. Hier, im Apfelgarten Europas hat wiederum Reinhold Messner seinen Hauptwohnsitz auf der Burg Juval. Entdeckt hatte ich die Alm auf der Suche nach einer alternativen Route für unsere Exkursion. Der derweil recht ausgetretene Fernwanderweg E5 ging mir schon recht schnell auf die Nerven, sodass ich 2010 erstmalig den Weg über den Alpenhauptkamm, durch das Gurgler Tal und über den gleichnamigen Gletscher wählte. Ein heftiger Wettereinbruch und 40 cm Neuschnee (im August !) versperrten uns den Weg über die Texelgruppe, und wir mussten durch das Pfossental absteigen. So fand ich die Mitterkaseralm und meine Liebe zu diesem Ort und zur Kultur der Bergbauern nahm ihren Anfang. Diese zwei Gebäude sind das Ende einer langen Geschichte und ein wunderschönes Beispiel für eine Jahrhunderte andauernde Nutzungskultur.
Die permanente Besiedlung der Alpen begann erst mit dem Abschmelzen der Gletscher vor gut 10.000 Jahren. Der Temperaturanstieg zum Ende der letzten Eiszeit erlaubte den nach Süden verdrängten Arten wieder nach Norden zu ziehen. Dabei bildeten die Alpen eine natürliche Barriere in dessen höheren Lagen einzelne Arten ihre idealen Lebensbedingungen vorfanden. Die Zirbe, das Murmeltier oder der Edelweis sind wohl die bekanntesten Migranten, die mit den vorstoßenden Gletschern nach Süden verdrängt wurden, den Rückweg in ihre asiatische Heimat aber nicht mehr ganz bewältigen konnten. In den Höhenlagen der Alpen fanden sie ihre neue Heimat. Ihnen folgten Jäger und Sammler die heimatlos durch die Berge zogen und sich von allem ernährten, was die Bergwelt ihnen unmittelbar liefern konnte. Schnell breitete sich in den gesamten Alpen ein geschlossener Bergwald aus, der bis auf die alpinen Graslandschaften oberhalb der Baumgrenze die gesamte Landschaft einnahm. Lediglich die Flussauen waren waldfrei, dafür aber ständig überflutungsgefährdet. Sümpfe, verwilderte Flussläufe, Murgänge und Felsstürze verhinderten hier zusätzlich eine dauerhafte Besiedlung. Eine massive Veränderung brachte die sogenannte neolithische Revolution, die Einführung von Viehwirtschaft und Ackerbau aus den vorderasiatischen Gebirgen. Vor ca. 6500 Jahren wanderten diese Techniken zunächst über das Mittelmeer und später über den Balkan in die Alpen ein, und ermöglichten den Menschen so zum ersten Mal eine ausreichend ertragreiche Sesshaftigkeit. Die Kultur der alpenländischen Wildmänner wurde verdrängt.


In direkter Abhängigkeit zum Klima entwickelten sich dabei drei zentrale Landwirtschaftsformen, die Transhumanz oder auch Wanderschafhaltung, welche sich vor allem in den Süd- und Südwestalpen durchsetzen konnte, die romanische und die germanische Landwirtschaft. Während die germanische Landwirtschaft hauptsächlich auf der Fleisch- und Viehwirtschaft basiert, finden sich in den wärmeren und trockeneren Bereichen der romanischen Wirtschaftsformen weitere landwirtschaftliche Kulturprodukte wieder. Roggen, Gerste, Hülsenfrüchte, in den tieferen Lagen Oliven, Esskastanien und Wein können unter den besseren klimatischen Bedingungen der südlichen Alpen und inneralpinen Trockentäler angebaut werden. Hierfür ist aber auch eine deutliche Umgestaltung der Landschaft notwendig, da die oft steilen Hänge durch Terrassenbau begradigt werden müssen. Die Römer führen zahlreiche Kulturpflanzen in die Alpen ein, bauen das Wegenetz über die großen Pässe aus und hinterlassen Teile ihrer Sprache. Das Rätoromanische in Graubünden oder Ladinische in Teilen der Dolomiten sind als eine Mischung aus Latein und den alten alpenländischen Sprachen zu verstehen.
Die Nutztierhaltung entwickelt sich langsam zu dem was wir heute oft allgemein als Almwirtschaft bezeichnen. Das Vieh steht im Winter in den Stallungen, wird im Sommer aber auf die „Alm“, also die großen alpinen Grasmatten oberhalb der Baumgrenze getrieben. Um diese Flächen zu vergrößern, wird die Waldgrenze durch Rodung nach unten verschoben. Die Almflächen vergrößern sich und durch das Vieh wird der Boden zusätzlich gedüngt. Diese saisonale Nutzung führt zu einer deutlichen Erhöhung der Artenvielfalt. Auch die Wanderschafhaltung hat einen ähnlichen Effekt. Die Tiere transportieren ungewollt Pflanzensamen aus dem Mittelmeerraum in die höheren Lagen der Südwestalpen und steigern so die Vielfalt der Pflanzenwelt. Erst deutlich später findet eine Urbarmachung der Täler statt. Meist wird zunächst auf großen Murkegeln gesiedelt, die sich deutlich über den Talgrund erheben. Erst Techniken zur Begradigung der Flüsse ermöglichen letztendlich eine Nutzung der Talauen.

Wie bei allem gibt es natürlich auch eine Kehrseite der Medaille. Kulturprotektionisten würden jetzt wahrscheinlich gleich von der wiedereinsetzenden Verwilderung der Alpen und dem Niedergang der traditionellen Almwirtschaft sprechen. Tatsächlich hat die intensive Landwirtschaft in den Tälern die traditionelle Bewirtschaftung verdrängt. Die Folge: Die alten Almflächen verbuschen, die Artenvielfalt geht zurück. Tatsächlich hat der Waldanteil in den Alpen in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zugenommen, was auch Luchs, Wolf und Bär wieder zurück in die Berge lockt. Wieviel Diskussionspotenzial in diesem Thema steckt, wenn Naturschützer, Bauern, der regionale Botanikerverband und Politiker an einem Tisch sitzen, kann man sich ungefähr vorstellen.
Eine Degradierung der Landschaft erleben wir aber vor allem auch durch den ungezügelten Ausbau touristischer Infrastruktur. Ob das Landschaftsbild nun dadurch unmittelbar beeinflusst wird oder nicht, der Energieverbrauch im Tourismussektor ist enorm, insbesondere im Wintertourismus. Lifte, Schneekanonen, beheizte Pools, ja sogar die 350.000 Duschen, die jeden Abend zur Winterhochsaison alleine von Touristen in Tirol angestellt werden, bringen die Stromnetze an ihre Belastungsgrenzen. Der Individualverkehr ist jedoch das größte Übel welches den Alpenländern zu jedem Wechseltag widerfährt. Ob durch die Luftverschmutzung direkt oder indirekt durch den Ausstoß von Treibhausgasen, die Alpen leiden am meisten durch den Verkehr. Ich will an dieser Stelle keinen Plan für eine nachhaltige Nutzung des Alpenraums vorstellen, aber wenn ihr den Bergen wirklich einen Gefallen tun wollt, dann setzt euch in den Zug und nicht in euer Auto!!
Ein großer Vorteil für die Alpen ist, dass den Tourismusverbänden das Potenzial ihrer Natur- und Kulturlandschaft durchaus bewusst ist. Traditionelle Landwirtschaft wird vielerorts wieder gefördert, alternative Tourismuskonzepte sollen den Impact verringern. Der Wintertourismus gerät durch den Klimawandel zunehmend unter Druck, und insbesondere kleine Gemeinden versuchen gezielt auf Sommertourismus zu setzen. Dies geschieht in unterschiedliche Richtungen. Das Angebot an Bikeparks und Trails wächst zunehmend, ebenso wie die Länge an Drahtseilen, die in Form von Klettersteigen in den Felswänden verbaut werden. An anderen Orten beruft man sich aber auch ganz klar wieder auf die alten Werte und lockt den Sommertouristen mit einem authentischen Bergdorfimage und entsprechenden Angeboten wieder zurück auf die Almwiesen. Das mag jetzt zynisch klingen, ich stehe diesem Wandel aber durchaus offen gegenüber. Insbesondere weil wir von den alten Nutzungsformen gerade in unserer heutigen Zeit viel lernen können!

Die neue „alte“ Nutzung
Es steht außer Frage, dass der natürliche Zustand unserer Ökosysteme die stabilste Form der Existenz darstellt. Der Mensch hat dieses System heute jedoch in ein solches Ungleichgewicht versetzt, dass man kaum noch auf die stellenweise katastrophalen Veränderungen reagieren kann, die durch unser handeln verursacht werden. Ungleichgewicht verursacht zwangsweise das Bestreben nach einem ausgeglichenen Zustand. Dies ist ein zentrales Naturgesetz. Wir sind jedoch Teil dieses Systems und müssen uns diesen „ausgleichenden“ Veränderungen zwangsweise mit zunehmendem Schmerz unterwerfen. Würden wir Menschen so langsam begreifen, dass wir ein Teil des natürlichen Kreislaufs sind und diesen nicht beherrschen, hätten wir deutlich weniger Probleme. Alleine die Aussage „Wir zerstören die Natur“ zeigt unsere Überheblichkeit. Wir zerstören nämlich uns!
Ich habe mich dazu entschlossen Optimist zu sein, und die Berge helfen mir dabei enorm. Ein Blick in die Geschichte der Alpen zeigt uns, dass die Menschen durchaus in der Lage sind in einem Gleichgewicht (heute nennen wir es „Nachhaltigkeit“) mit der Natur zu leben. Über Jahrhunderte mussten die Menschen hier erfahren was es bedeutet die Natur zu übernutzen. Holzte man zu viel Wald ab, kam es zu verheerenden Lawinen. Hat man zu viele Kühe auf die Alm getrieben, erodierten die Böden und wurden unbrauchbar. Die Natur hat das Maß der Nutzung vorgegeben, und der Mensch hat sich ihr angepasst. Wie die meisten Naturvölker kannten die Alpenbauern ihren Lebensraum und haben diesen mit Rücksicht behandelt. Die Alpen sind bzw. waren somit ein wunderbarer Modellraum für das, was wir auf Dauer auf diesem Planeten anstreben sollten. Eine nachhaltige Nutzung unserer Ressourcen bei einem möglichst geringen Impact für die Natur. In unserem Wissen und dem technischen Fortschritt liegt unglaublich viel Potenzial. Wir sollten uns jetzt an die Arbeit machen eben dieses auszuschöpfen.

Die Alpen sind nicht nur reich an Schönheit, Geschichte und Kultur. Die alten Nutzungsformen geben uns zahlreiche Beispiele für einen besseren Umgang mit der Natur. Landwirtschaft und unsere Nahrungsmittelproduktion werden die zentralen Herausforderungen unserer Zukunft darstellen, und hierbei können wir uns das Gleichgewicht, welches in den Alpen über Jahrhunderte bestand hatte nur zum Vorbild nehmen. Wir müssen nicht erst so tun als seien wir ein Bergbauer um nach diesen Regeln zu handeln. Schon immer waren und sind wir genauso von der Natur abhängig, wie alle Naturvölker vor uns. Technik und Fortschritt suggerieren uns allerdings eine Überlegenheit, die wir nie besessen haben. Die Alpenüberquerung ist bis heute übrigens meine Lieblingsexkursion geblieben. Zwar hat meine Faszination für die geologische Entwicklung bis heute nicht nachgelassen, am meisten begeistern mich jedoch die zahlreichen neuen nachhaltigen und zukunftsweisenden Nutzungsmöglichkeiten, die aus einer tiefen Liebe zur Natur entstanden sind.
Die Mitterkaseralm, ein Paradebeispiel für diese „neue“ alte Landnutzung, wird seit letztem Jahr nicht mehr bewirtschaftet. Sie fiel jedoch nicht einem Staudamm oder einem neuen Skigebiet zum Opfer. Das Haupthaus, welches zum Lawinenschutz im Hangbereich dem Gelände angeglichen war, wurde von den Erdmassen über die Jahrhunderte talabwärts gedrückt, sodass schlichtweg eine sichere Statik nicht mehr gewährleistet werden konnte. Ich hoffe jedoch inständig, dass die „Infanglers“, die ihren Haupthof immer noch im Schnalstal haben, ihre Mission nicht gänzlich aufgeben und irgendwann im Frühling wieder hinauf auf die Alm ziehen werden.